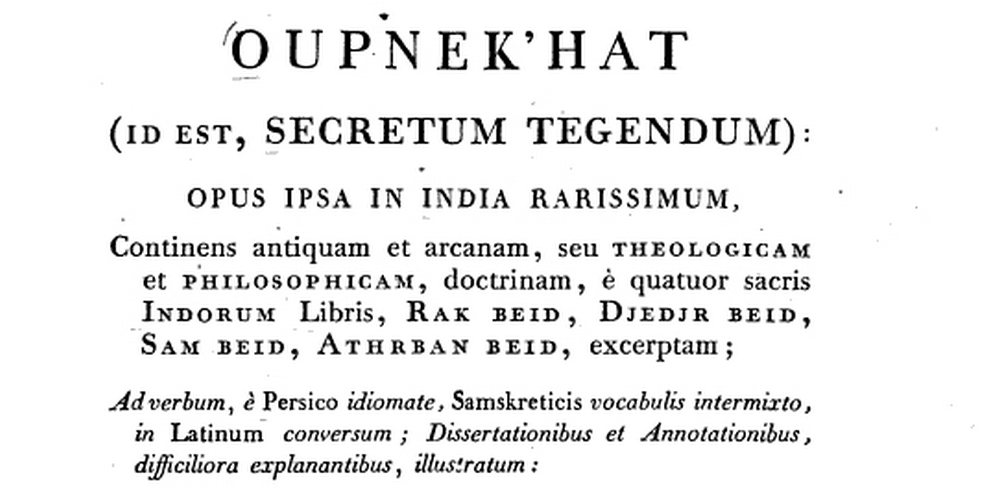Schopenhauers alter Freund, «Erzevangelist» und erster Herausgeber seiner Werke, der Philosoph Julius Frauenstädt (1813-1879), schrieb, es habe Schopenhauer an «Nüchternheit im praktischen Leben» gefehlt und er habe «nicht jene persönliche Würde» gezeigt, «die man gewöhnlich mit dem Begriff eines Philosophen verbindet. Dies konnte ich nicht blos damals schon wahrnehmen, als er […] sein barsches Naturell gegen mich herauskehrte, so dass ich vorläufig meine Besuche bei ihm einstellte [...]. Auch sein Ton in seinen Briefen und sein Ton gegen seine Gegner, die Philosophieprofessoren und dänischen Akademiker, ist nicht immer der würdige, den man von einem Philosophen erwartet und der z.B. bei Kant überall anzutreffen ist.» Der Philosoph in Frankfurt versprühte Invektiven nach allen Seiten, in Gesprächen und Briefen, in seinen Gedankenbüchern – darüber könnte ich ein Liedlein singen –, in seinen Werken, so dass Arthur Hübscher (1897-1985) einen Beitrag schrieb mit dem Titel «Schopenhauer und die Kunst des Schimpfens» (1981), und Franco Volpi fügte bei, der Katalog von Beschimpfungen, Schmähungen, Injurien und Beleidigungen an alle möglichen Adressaten die er aus Schopenhauers Werken und seinem Nachlass aufgelesen und unter dem Titel «Die Kunst zu beleidigen» (2002) zusammengestellt habe, sei der Beleg hiervon.
Über den Lärm
Gehörig ärgern konnte sich der Philosoph auch über Alltäglichkeiten: Pfeifen, Trommeln, Heulen, Brüllen, Kindergeschrei und Hundegebell, Türenwerfen, Klopfen, Hämmern und Rammeln fand er zwar entsetzlich; «aber der rechte Gedankenmörder ist allein der Peitschenknall». Schopenhauer hat «das wahrhaft infernale Peitschenklatschen, in den hallenden Gassen der Städte» als den «unverantwortlichsten und schändlichsten Lerm» bezeichnet und geklagt, «daß eine solche Infamie in Städten geduldet wird, ist eine grobe Barbarei und eine Ungerechtigkeit; um so mehr, als es gar leicht zu beseitigen wäre, durch polizeiliche Verordnung eines Knotens am Ende jeder Peitschenschnur». Er sieht auch nicht ein – «bei allem Respekt vor der hochheiligen Nützlichkeit» –, wieso «ein Kerl, der eine Fuhr Sand oder Mist von der Stelle schafft, dadurch das Privilegium erlangen soll», jeden etwa aufsteigenden Gedanken in vielen Köpfen mit seinem vermaledeiten Peitschenknallen im Keime zu ersticken. In «Ueber Lerm und Geräusch» schimpft er kräftig drauflos. «Dieser plötzliche, scharfe, hirnlähmende, alle Besinnung zerschneidende, gedankenmörderische Knall muß von Jedem, der nur irgend etwas, einem Gedanken Aehnliches im Kopfe herumträgt, schmerzlich empfunden werden: jeder solcher Knall muß daher Hunderte in ihrer geistigen Thätigkeit, so niedriger Gattung sie auch immer seyn mag, stören: dem Denker aber fährt er durch seine Meditationen so schmerzlich und verderblich, wie das Richtschwerdt zwischen Kopf und Rumpf.»
Für den Philosophen ist der Lärm «die impertinenteste aller Unterbrechungen, da er sogar unsere eigenen Gedanken unterbricht, ja, zerbricht. Wo jedoch nichts zu unterbrechen ist, da wird er freilich nicht sonderlich empfunden werden.» Er hält «die allgemeine Toleranz gegen unnöthigen Lerm» (man könnte hier auch von einer gewissen Sorte heutiger «Musik» reden!) geradezu für «ein Zeichen der allgemeinen Stumpfheit und Gedankenleere der Köpfe», und «von der Gedankenlosigkeit des Menschengeschlechts» gibt ihm nichts «einen so großen Begriff, wie die ungehinderte Licenz des Peitschenklatschens».