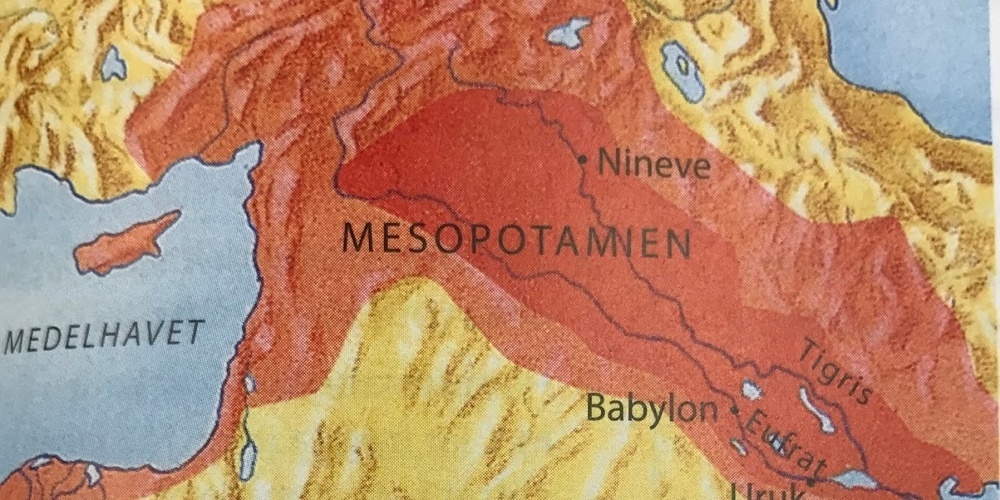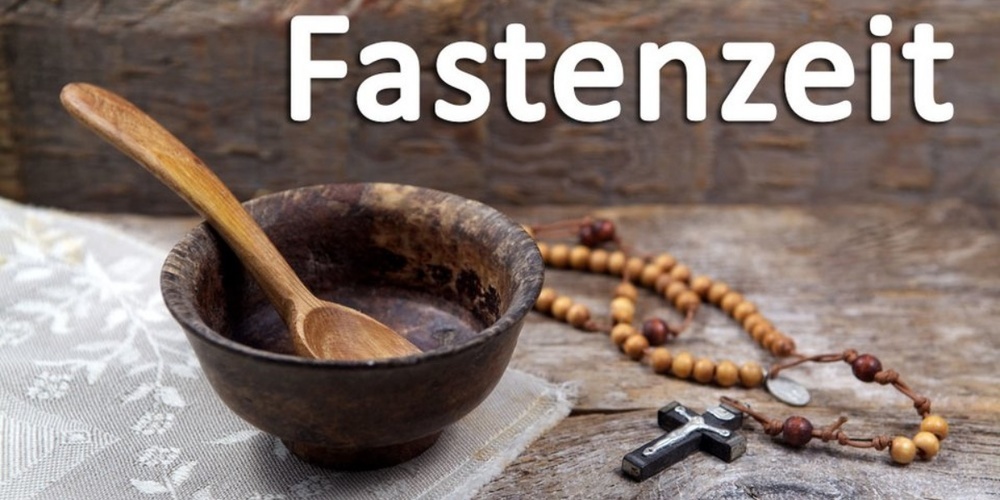Um Mitternacht endet der Karneval
Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. In der Nacht zu Aschermittwoch um Punkt Mitternacht endet der Karneval, und es gibt an vielen Orten die Tradition, dass die Karnevalisten in dieser Nacht eine Strohpuppe, den so genannten Nubbel, als Verantwortlichen für alle Laster der karnevalistischen Tage verbrennen.
Auf den Nubbel werden die in der Karnevalszeit begangenen Verfehlungen oder Sünden gelegt, damit diese nach der Vernichtung nicht mehr gelten können.
Dieser Schelm oder Hanswurst hatte Ähnlichkeit mit Till Eulenspiegel und den mittelalterlichen Hofnarren. So wird berichtet, dass es im 18. und 19. Jahrhundert am Niederrhein der kleinen Leute Brauch war, in der Nacht auf Aschermittwoch ausgerüstet mit Stangen, an denen Würste hingen, durch die Straßen zu laufen und lustige Lieder zu singen.