1702 kam der St.Galler Laurenz Halder als einfacher Söldner auf der indonesischen Insel Java an. Er hatte eine gefährliche Reise hinter sich: Von Holland aus war er zusammen mit anderen Soldaten in See gestochen. Sie befanden sich auf einem Schiff der Vereinigten Ostindien-Kompanie (VOC), die seit 1602 die von den Portugiesen eroberten Stützpunkte der Niederlande in Süd- und Südostasien verwaltete.
Wie ein St. Galler Söldner in Malakka versklavt wurde


Kolonialhändlerin mit Monopol
Die VOC bestand aus einem Zusammenschluss der sieben unabhängigen Provinzen der Niederlande und deren wichtigsten Wirtschaftsunternehmen. Sie war die zweite Aktiengesellschaft in Europa, die es gab. Alle grossen niederländischen Handelshäuser beteiligten sich und besassen als Aktionäre und Mitinhaber Anteilscheine. Zur Deckung ihres riesigen Kapitalbedarfs wurde 1606 die Amsterdamer Effektenbörse gegründet.
Wirtschaftlicher Zweck der Gesellschaft war der Kolonialhandel, weshalb die Niederlande sie mit einem umfassenden Handelsmonopol versah. Nur ihren Händlern und Schiffen war es erlaubt, die wertvollen Gewürze und Erzeugnisse aus den Kolonien nach Europa zu bringen. Einziges erlaubtes Ausfuhrziel waren die Niederlande.
Voraussetzung für diesen globalen Handel war die wirtschaftliche und politische Kolonisation, die sich vor allem auf wichtige Stützpunkte und Handelsorte entlang der Küste des Indischen Ozeans fokussierte. Der lukrative Handel, vor allem mit Gewürzen wie Pfeffer und Muskat, und die militärische Unterdrückung von Aufständen wurden mithilfe eines von der VOC angestellten Söldnerheers gewährleistet.
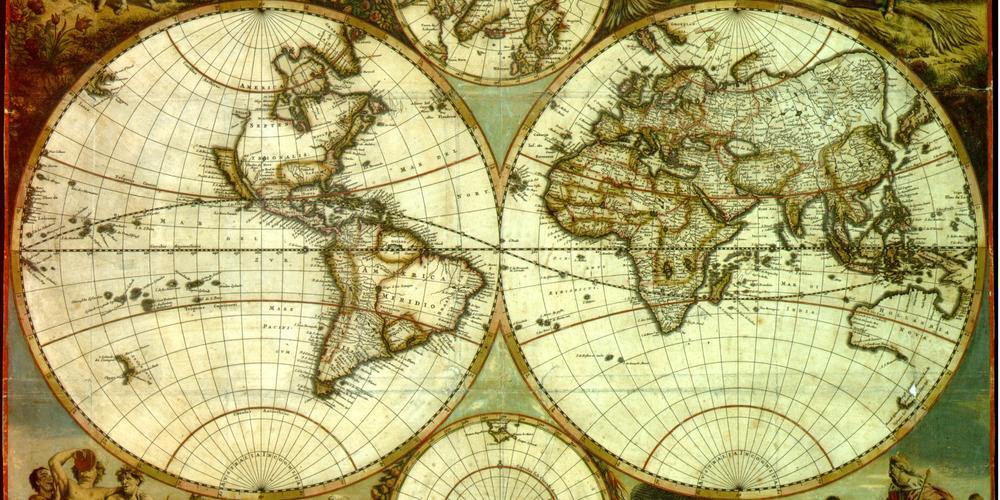
Arme Handwerker als Söldner
Auch der St.Galler Laurenz Halder stand im Sold der VOC. In Batavia (heutiges Jakarta, Hauptstadt Indonesiens) angekommen, lernte er rasch andere Ostschweizer kennen, etwa einen Nägeli aus Teufen, der wie er einfacher Söldner war, einen reichen Glarner namens Ludwig Caesar, der auf Java eine Gastwirtschaft führte und den Söldnern «indianische Speisen und Getränke» servierte. Auch mit der Witwe eines Zollikofers aus St.Gallen machte er in Indonesien Bekanntschaft.
In Halders indonesischem Beziehungsnetz spiegeln sich die Tätigkeiten von Ostschweizern in den früheren Kolonien der Seemächte. Die Mehrheit der Schweizer kam als Söldner nach Indonesien. Es handelte sich häufig um wenig vermögende Handwerker, die aus wirtschaftlicher Not oder um ihr Glück woanders zu suchen die Heimat verliessen.
Die meisten von ihnen kehrten allerdings nicht mehr zurück. Die VOC rechnete bereits während der gefährlichen Schiffpassage von Holland nach Indonesien mit 20 Prozent Verlust an Mannschaft und Ware.
Halder selbst hatte Glück im Unglück: Nach vier Monaten Dienst in Jakarta wurde er während einer Schiffsreise gefangen genommen und in Malakka versklavt. Nach seiner «Erlösung», wie es in der Quelle heisst (vielleicht wurde er gegen die Leistung eines Lösegelds freigekauft), kehrte er nach Jakarta zurück und arbeitete dort noch eine kurze Zeit als Söldner, bis er wieder mit dem Schiff nach Holland zurückkehrte. 1708 heiratete er schliesslich in der Stadt St.Gallen eine Schneiderstochter.

Überlebt, aber nicht reich geworden
Wirtschaftlich hatte sich das Abenteuer für Halder nur bedingt gelohnt: Er gab an, 560 Gulden samt einer Kiste mit Habseligkeiten in seiner Zeit als Söldner in Ostindien verdient zu haben. Zum Vergleich: Kleine Häuser im städtischen Territorium hatten zu dieser Zeit einen Wert zwischen 600 und 800 Gulden. Halder versteuerte nach seiner Heirat ein Steuervermögen zwischen 200 und 300 Gulden und zählte damit zur zweittiefsten Steuergruppe in St.Gallen. Andere St.Galler hatten weniger Glück: Heinrich Leutmann und Hans Jacob Mörli starben Ende des 17. Jahrhunderts auf Java.
Zur Schweizer Kolonie in Indonesien zählten aber auch Handelsleute, wie möglicherweise der von Halder erwähnte Zollikofer und sonstige Gewerbetreibende wie der Glarner Caesar, in dessen Wirtschaft Halder in Jakarta jeweils einkehrte. Im Gegensatz zu Halder und Nägeli, der nur «wenig mit sich gebracht» hatte, war Caesar auf Java reich geworden. Er besass mehrere Pferde und Kutschen, die er auch vermietete, und lebte in einem herrschaftlichen Haus in Jakarta. Er beschäftigte Sklaven und war «ein wolbesezter, dickher Mann von rechter Länge gewesen».
Dem Tod Ludwig Caesars ist die Überlieferung dieser hier berichteten Geschichte zu verdanken. Denn der Rückkehrer Halder wurde von der St.Galler Obrigkeit zu seinem Leben und seinen Kontakten in Indonesien und insbesondere über Caesar selbst befragt. Caesars Tod auf Java machte offenbar weitere Abklärungen nötig, weshalb die Glarner Obrigkeit den St.Galler Rat um eine Zeugenvernehmung Halders bat.