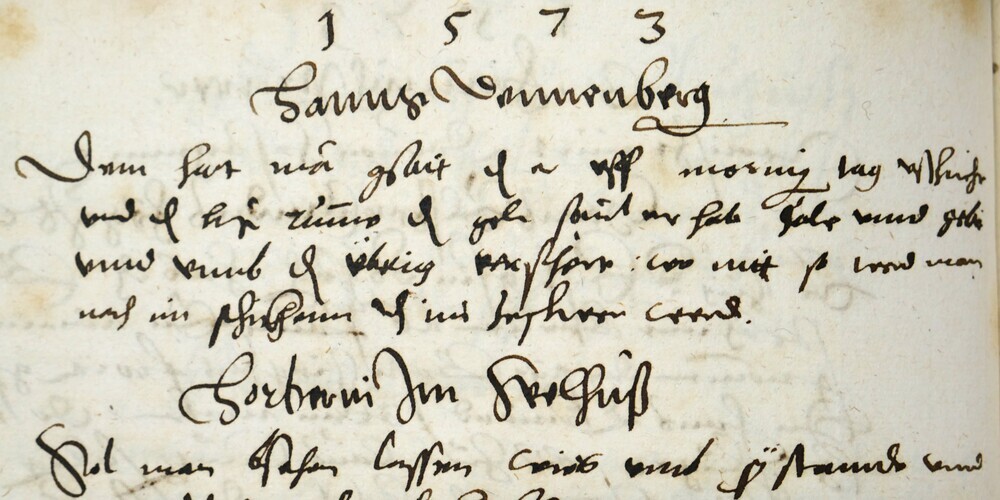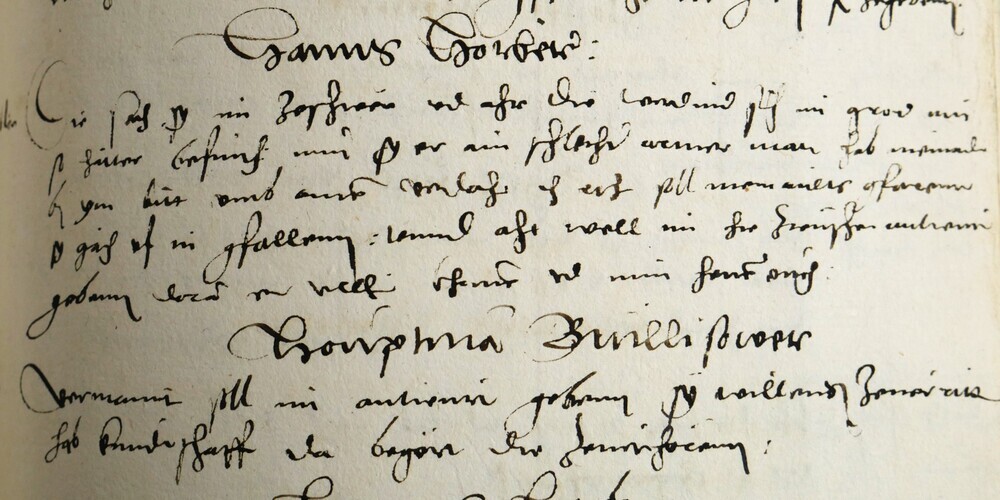Am 7. November 1557 schrieben Bürgermeister und Rat von Zürich ihren Amtskollegen in der Gallusstadt einen Brief und orientierten sie über eine Bitte der St.Gallerin Magdalena Horber. Dieses «arme mentschlin» – ein Begriff, der für unverheiratete Mägde gebraucht wurde – war im Vorjahr bei der Heuernte in Unterwalden von einer Schlange gebissen worden.
Die daraus resultierende Verletzung war aber nie ordentlich verheilt. Deshalb hatte sich Magdalena Horber in Zürich von einem Wundarzt operieren lassen müssen. Sowohl der chirurgische Eingriff als auch die nachfolgende Pflege hatten nun aber ihre gesamten Ersparnisse aufgebraucht. Deshalb bat sie auf offiziellem Weg über den Zürcher Rat, dass die St.Galler Obrigkeit ihre Verwandten «umb ein stür und hilf» anhalte.
Das Ziel des Schreibens war es also, dass die in St.Gallen und Umgebung lebenden Angehörigen Magdalena Horber finanziell unter die Arme griffen.